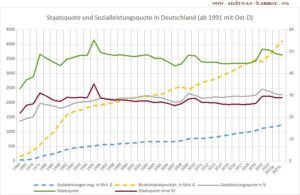Der Referentenentwurf zur Änderung des SGB II und SGB III (Entwurf eines Dreizehnten Gesetzes zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze) vom 16. Oktober 2025 ist inzwischen zugänglich. Interessant ist dabei nicht nur der Inhalt, sondern auch der Weg an die Öffentlichkeit: Betroffene erhielten den Entwurf nicht direkt, während einige wenige, ausgewählte Medien frühzeitig Einblick bekamen.
Unabhängig von einer inhaltlichen Bewertung lassen sich einige zentrale Punkte hervorheben. Der Entwurf wird sich voraussichtlich noch ändern. Der derzeit bekannte Teil umfasst ausschließlich Regelungen, die keiner Zustimmung des Bundesrates bedürfen. Ein weiteres Gesetzgebungsverfahren mit den zustimmungspflichtigen Änderungen wird also folgen.
Zudem enthält der aktuelle Entwurf nicht alle Punkte, auf die sich der Koalitionsausschuss am 9. Oktober 2025 geeinigt hat – offenbar war die Zeit dafür zu knapp. Diese Bestandteile sollen im weiteren Verlauf des Verfahrens ergänzt werden. Ebenso könnten Vorschläge der Sozialstaatskommission aufgenommen werden, deren Bericht für Januar 2026 angekündigt ist.
Eine fundierte Bewertung der geplanten Änderungen ist daher erst möglich, wenn alle Teile des Gesetzgebungspakets vorliegen. Schon jetzt zeigt sich jedoch, dass der Entwurf sowohl die Regelungen zu Sanktionen im SGB II als auch das SGB III betrifft. Letzteres deutet darauf hin, dass die Zuständigkeit für unter 25-Jährige von den Jobcentern auf die Bundesagentur für Arbeit übergehen könnte – ein Vorhaben, das in der Vergangenheit bereits diskutiert wurde. Diese mögliche Zuständigkeitsverschiebung wäre, ähnlich wie der frühere Wechsel bei der Weiterbildung, eine richtungsweisende Entscheidung mit langfristigen Folgen.
Darüber hinaus finden sich im Entwurf auch technische Neuerungen, etwa eine Experimentierklausel für die Zentrale der Bundesagentur für Arbeit zur Weiterentwicklung der IT im Bereich des SGB II. Den rund 100 zugelassenen kommunalen Trägern wird eine solche Möglichkeit hingegen nicht eingeräumt. Da IT-Strukturen maßgeblich Arbeitsprozesse und Organisationsformen prägen, besitzt diese Regelung erhebliche praktische Tragweite.
Deutlich wird auch, dass der Vermittlungsvorrang nicht in seine alte Form vor Inkrafttreten des Bürgergeldgesetzes zurückgeführt wird. Früher galt: Vermittlung in Arbeit hatte Vorrang vor Qualifizierung oder Maßnahmenteilnahme. Nun lautet die Formel: Vermittlung in Arbeit vor Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts – ein Unterschied, der weit über reine Wortwahl hinausgeht.
In den kommenden Monaten gilt es, die weiteren internen und veröffentlichten Unterlagen zu den geplanten Änderungen kritisch zu prüfen, fachlich zu hinterfragen und konstruktiv mit Verbesserungsvorschlägen zu begleiten.