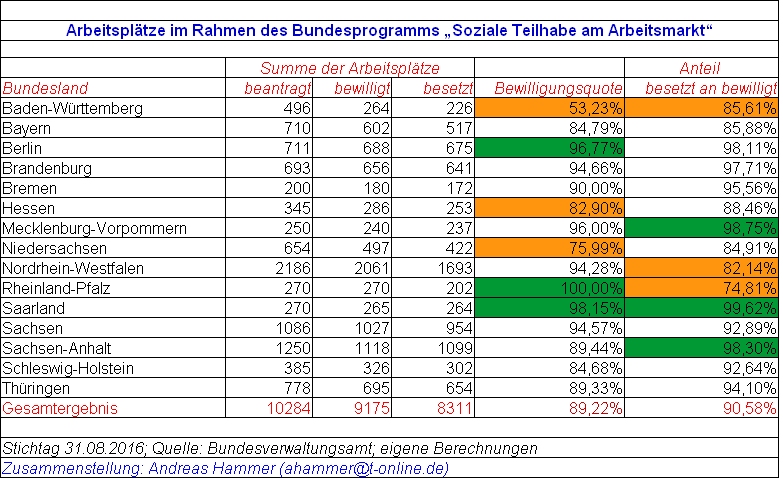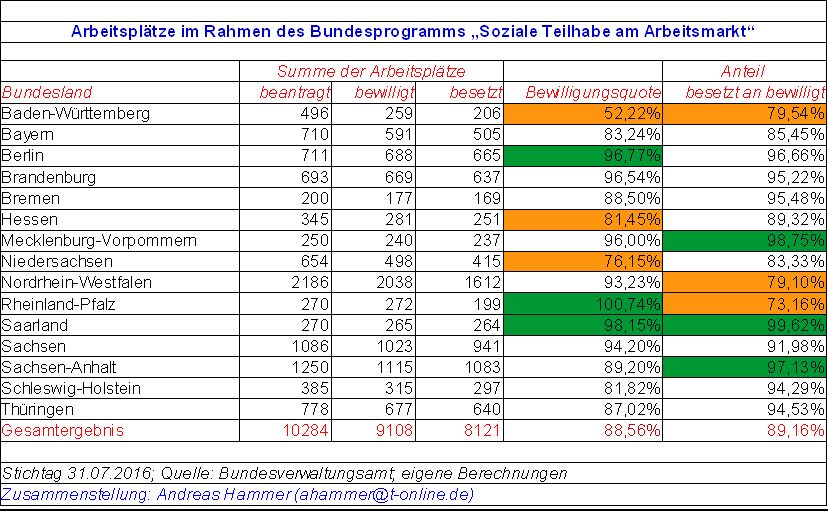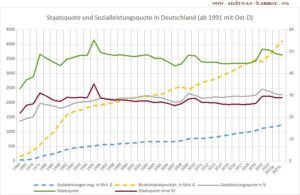Stehen sog. 1-Euro-Jobs (Arbeitsgelegenheiten nach § 16d SGB II) schon seit Jahren in der Diskussion der Arbeitsmarktpolitik als Förderinstrument, sind zum 1.8.2016 Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen als Arbeitsgelegenheiten nach § 5a Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) hinzugekommen. Weniger in der öffentlichen Wahrnehmung finden sich die Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylbLG. Diese existieren ebenfalls schon seit Jahren. Dieser Instrumententyp soll im folgenden beleuchtet werden.
-
Archiv
-
Neueste Beiträge
- 10 JAHRE „SOMMER DER MIGRATION“ UND “FLÜCHTLINGSKRISE”
- SGB-Reform 2025: Was der aktuelle Entwurf (noch) nicht zeigt
- Strukturwandel im Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein-System: Trends, Ursachen und Handlungsbedarf
- Zuständigkeitswechsel Weiterbildung: Rückgang bei der Bundesagentur für Arbeit um mehr als ein Drittel
- Eingliederungsleistungen und Effizienz der Jobcenter und Träger
- Steuerliche Änderungen für gemeinnützige Organisationen
- Überalterung, Sozialstaatskrise?
- §16h SGB II: Jugendliche frühzeitiger fördern, Wirksamkeit erhöhen
Kategorien
Schlagwörter
- 16i
- Arbeitgeber
- Arbeitslose
- Arbeitslosenstatistik
- Arbeitslosigkeit
- Armut
- Ausbildung
- Ausländer
- Beschäftigungsträger
- Bremen
- Bundesagentur für Arbeit
- Bundeshaushalt
- Bundesregierung
- CDU
- Corona
- Covid19
- Diskriminierung
- Eingliederung
- Erwerbstätigkeit
- FDP
- Flüchtling
- Frauen
- Grüne
- Hamburg
- Hessen
- Jobcenter
- Kurzarbeit
- Langzeitarbeitslose
- Langzeitarbeitslosigkeit
- Langzeitleistungsbeziehende
- Leistungsminderung
- Mindestlohn
- Pandemie
- Saarland
- Sanktion
- Selbständige
- SGB III
- SodEG
- sozialer Arbeitsmarkt
- Soziale Teilhabe
- SPD
- Statistik
- Teilhabechancengesetz
- Träger
- Ukraine
-
-
-
-