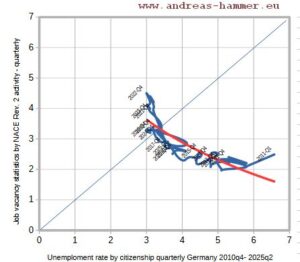Der folgende Beitrag zeichnet die Entwicklung des § 16e SGB II nach, um die politische Zielrichtung und praktische Tragweite der geplanten Neuregelung im 13. Änderungsgesetz zum SGB II einordnen zu können.
Weiterlesen: § 16e SGB II im Wandel: Historie und Bewertung der Neuregelung durch das 13. ÄnderungsgesetzChronologie
§ 16e SGB II wurde am 1. Januar 2009 als „Leistungen zur Beschäftigungsförderung“ eingeführt. Die Vorgängerregelung gleicher Bezeichnung befand sich zuvor in § 16a SGB II. Arbeitgeber konnten damals zusätzlich zum Lohnkostenzuschuss eine Förderung erhalten
- für Kosten einer begleitenden Qualifizierung bis zu 200 Euro monatlich (pauschaliert) sowie
- in begründeten Einzelfällen für weiteren Aufwand beim Aufbau von Beschäftigungsmöglichkeiten.
Seitdem wurde das Instrument wiederholt überarbeitet – sowohl in seinen Fördervoraussetzungen als auch in seiner Bezeichnung:
| Zeitraum | Bezeichnung | Bemerkung |
|---|---|---|
| bis 2008 | § 16a Leistungen zur Beschäftigungsförderung | Ursprungsregelung |
| ab 2009 | § 16e Leistungen zur Beschäftigungsförderung | aus § 16a überführt, geändert 2011 |
| ab 2012 | Förderung von Arbeitsverhältnissen | geändert 2016 |
| ab 2019 | Eingliederung von Langzeitarbeitslosen | Bürgergeldgesetz |
| ab 2025 (geplant) | Eingliederung von Langzeitleistungsbeziehenden | Änderung von Langzeitarbeitslosigkeit zum Langleistungsbezug als Förderkriterium |
Über die Jahre wurde die Förderung für Arbeitgeber wie auch für erwerbsfähige Leistungsberechtigte restriktiver ausgestaltet. Das Potenzial der Förderfähigen wurde so verkleinert. Bislang ist es dem Gesetzgeber nicht gelungen, ein Instrument zu etablieren, das spürbar zum Abbau von Langzeitarbeitslosigkeit oder langfristigem Leistungsbezug beiträgt.
Gesetzgeberische Zielrichtung
Mit der geplanten Neuregelung als „§ 16e Eingliederung von Langzeitleistungsbeziehenden“ soll der Kreis der förderfähigen Personen bei gleichbleibenden Bedingungen wieder erweitert werden. Im Referentenentwurf heißt es:
„Derzeit gibt es etwa doppelt so viele arbeitslose Langzeitleistungsbeziehende im SGB II wie Langzeitarbeitslose (552 Tsd.), die zwei Jahre und länger arbeitslos sind. Insbesondere Frauen und geflüchtete Menschen werden profitieren, da sie bisher aufgrund von Kinderbetreuungszeiten oder der Teilnahme an Integrationskursen die Voraussetzungen der Langzeitarbeitslosigkeit nicht immer erfüllen konnten. Zum Beispiel würde die Fördervoraussetzung basierend auf dem Langzeitleistungsbezug die Zielgruppe der zugangsberechtigten Frauen um über 360 Tsd. Personen erhöhen – eine Steigerung um 149 Prozent. Frauen mit Fluchthintergrund profitieren besonders stark.“
Praktische Herausforderungen
Allerdings ist zu berücksichtigen, dass die Zahl der Langzeitleistungsbeziehenden zuletzt insbesondere durch ukrainische Geflüchtete gestiegen ist, die mittlerweile lange genug im Leistungsbezug stehen. Viele von ihnen verfügen jedoch nur über geringe Sprachkenntnisse, unzureichende Berufsanerkennung oder keine gesicherte Kinderbetreuung – Voraussetzungen, die eine versicherungspflichtige Beschäftigung erschweren.
Auch die finanzielle Lage der Jobcenter wirkt als Begrenzungsfaktor (vgl. „Eingliederung von Arbeitslosen im SGB II – reale Mittelplanung 2024 so niedrig wie nie“ ). Solange keine Budgetklarheit für die Jahre ab 2027 besteht, greifen viele Jobcenter vermutlich lieber auf den einjährigen Eingliederungszuschuss (EGZ) zurück, der finanziell günstiger und wirksamer erscheint: Die durchschnittliche Eingliederungsquote liegt laut Statistik bei 76,6 Prozent für den EGZ, aber nur bei 6,2 Prozent für § 16e SGB II (Austritte 2023/24; Verbleib nach 6 Monaten). Auch Arbeitgeber nutzen den EGZ häufiger, vermutlich wegen der kürzeren Vertragsdauer.
Mit der Neuregelung sollen künftig zwei Rechtsgrundlagen parallel bestehen:
- § 16e SGB II: Leistungsbezug mindestens 21 Monate in 24
- § 16i SGB II: ab 25 Jahren, mindestens 6 Jahre innerhalb der letzten 7 im Leistungsbezug, für Erziehende oder Personen mit Schwerbehinderung durchgehender Leistungsbezug in den letzten 5 Jahren
Ein Übergang von § 16e zu § 16i ist nicht vorgesehen.
Bedeutung für die Praxis
Die Zahl der § 16e‑Förderungen ist in den vergangenen Jahren deutlich gesunken (vgl. „5 Jahre Eingliederung von Langzeitarbeitslosen“). Inzwischen spielt das Instrument selbst bei Beschäftigungsträgern eine untergeordnete Rolle. Ein nachhaltiger Aufbau von Arbeitsplätzen ist nur dann realistisch, wenn Förderbedingungen und Finanzierung langfristig gesichert und planbar sind.
Jedes fünfte Jobcenter nutzt § 16e derzeit gar nicht mehr („Jedes 5. Jobcenter ohne Eingliederung von Langzeitarbeitslosen nach § 16e SGB II“).
Vorschläge für die Weiterentwicklung
Für eine praktikablere Ausgestaltung wäre zu überlegen, den § 16e SGB II sowohl auf Langzeitarbeitslose als auch auf Langzeitleistungsbeziehende anzuwenden. Ebenso sollte die Förderung sonstiger Kosten (Sprachförderung, Qualifizierung, sozialpädagogische Begleitung oder Aufwendungen für den Aufbau von Beschäftigungsmöglichkeiten) wieder möglich sein.
Um Mitnahmeeffekte zu vermeiden, könnten diese Zusatzförderungen auf gemeinnützige Träger beschränkt werden.
Der Erfolg des Instruments hängt langfristig davon ab, ob es gelingt, die Förderlogik stärker auf individuelle Integrationschancen und die Realität heterogener Zielgruppen auszurichten.