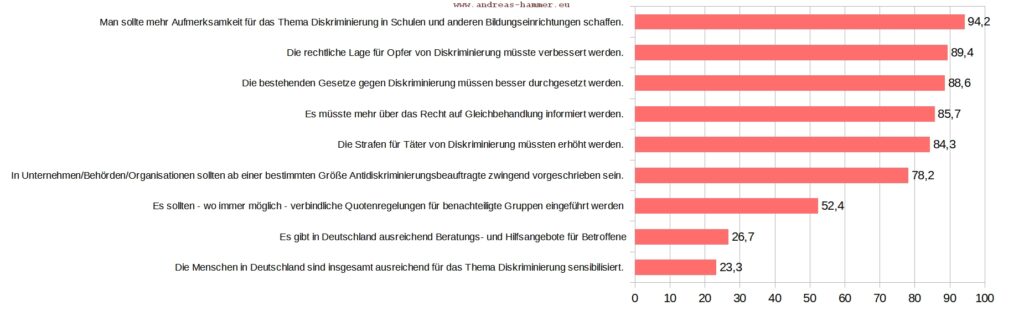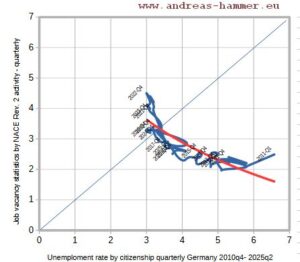Die Datenlage zum Thema Wohnungs- oder Obdachlosigkeit ist in Deutschland sehr schlecht. Es gibt bislang keine amtliche Statistik, die erst ab 2022 geplant ist. Daten stammen meist von Trägern der Wohnungslosenhilfe. Eine Befragung in Berlin in 2015 hat u. a. die Problemlagen von Wohnungslosen, die betreut werden, erhoben (Dornbach, Stefan 2016: Erfolg in der Wohnungslosenhilfe. Klientenbezogene Einflussfaktoren auf den Abschluss von ambulanten Betreuungen. In: wohnungslos, Zeitschrift der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe e.V., Heft 3/2016). Diese Informationen ermöglichen zu prüfen, ob es verschiedene Typen von Wohnungslosen gibt, was aufgrund der multikausalen Auslöser von Wohnungslosigkeit zu vermuten ist.
Erhoben wurden 1.277 Datensätze von abgeschlossenen Betreuungen in der Berliner Wohnungslosenhilfe und dazu jeweils das Vorhandensein folgender sozialer Problemlagen:
- Arbeitslosigkeit,
- Straffälligkeit,
- Haftentlassung,
- Alkoholprobleme,
- Drogenprobleme,
- Überschuldung,
- Gewalterfahrung,
- psychische Auffälligkeit und Krankheit sowie
- körperliche und geistige Beeinträchtigung
Mithilfe einer Clusteranalyse habe ich geprüft, ob es verschiedene problembezogene Typen von Wohnungslosen gibt. Ein sinnvolles Ergebnis zeigt eine Auflösung von drei Clustern:
Clusterzentren der Ausgangsklassifikation ╭─────────────────────────────────┬───────────╮ │ │ Cluster │ │ ├───┬───┬───┤ │ │ 1 │ 2 │ 3 │ ├─────────────────────────────────┼───┼───┼───┤ │Ll_arbeitslos_über_1_jahr │1,3│1,4│1,7│ │Ll_haftentlassung │2,0│1,7│2,0│ │Ll_straffälligkeit │2,0│1,1│1,9│ │Ll_überschuldung │1,7│1,3│1,2│ │Ll_gewalterfahrung │1,6│1,5│2,0│ │Ll_alkohol │1,9│1,6│1,9│ │Ll_drogen │1,8│1,5│1,9│ │Ll_psychisch_auffällig │1,4│1,7│1,8│ │Ll_psychisch_krank__diagnose_ │1,9│2,0│1,9│ │Ll_körperlich___geistige_beeintr_│1,9│1,9│1,9│ ╰─────────────────────────────────┴───┴───┴───╯
Die Häufigkeit der Cluster stellt sich wie folgt dar:
Anzahl der Fälle in jedem Cluster ╭─────────┬──────────────────────╮ │ │Beobachtete Häufigkeit│ ├─────────┼──────────────────────┤ │Cluster 1│ 415│ │ 2│ 306│ │ 3│ 555│ │Gültig │ 1276│ ╰─────────┴──────────────────────╯
Cluster 3 kommt am häufigsten vor, Cluster 2 am wenigsten.
In allen Clustern werden multiple soziale Problemlagen der Wohnungslosen sichtbar. Darüber hinaus gibt es einige Unterschiede:
- Cluster 1 beinhaltet vor allem Langzeitarbeitslose (betrifft übrigens rd. 48 % der Datensätze) und psychisch auffällige Wohnungslose.
- In 2. Cluster dominieren vor allem Straffällige (etwa 26 % aller Fälle).
- Im Cluster 3 finden sich eher überschuldete Personen (ca. 63 % aller Betreuungsfälle).
Diese Unterscheidung kann Hinweise geben auf angepasste Unterstützungsstrategie und -angebote.
Unabhängig vom Betreuungserfolg habe ich geprüft, ob die Clustertypen sich auf die Belegungsdauer der Wohnungslosen in Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe auswirken. Die durchschnittliche Belegungsdauer entspricht 316 Tagen (Minimum: 2, Maximum: 1.145 Tage). 316 Tage waren es ebenfalls bei Cluster 2. Im Cluster 1 beträgt der entsprechende Wert 326 Tage und im Cluster 309 Tage. Die Unterschiede sind demnach nicht sehr groß – für einen Kostenträger kann das dennoch von Bedeutung sein.
╭──────┬──────────┬────┬───────────────╮ │Clust.│Mittelwert│ N │Std. Abweichung│ ├──────┼──────────┼────┼───────────────┤ │1 │ 326,36│ 415│ 215,81│ │2 │ 316,18│ 306│ 199,89│ │3 │ 308,66│ 555│ 208,45│ │Gesamt│ 316,22│1276│ 208,85│ ╰──────┴──────────┴────┴───────────────╯
In einer Evaluation eines Projektes für schwer erreichbare junge Menschen konnten wohnsitzlose Arbeitslose (überwiegend aus einem Übergangswohnheim) in einem hohen Maß in Arbeit integriert werden, ohne dass zuvor das Wohnungsproblem gelöst war (s. Hammer 2021: „Wir für Sie und zwar für alle! Barrierefreiheit, ein Prozess“. Dialog 45, Magazin der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg). Insbesondere Arbeitslosigkeit steht in den Berliner Daten in einem signifikanten Zusammenhang mit der Belegungsdauer. Die Strategie Beschäftigung (im Rahmen eines Projektes) vor Wohnung könnte allgemein hilfreich sein.
Alle Berechnungen: Andreas Hammer